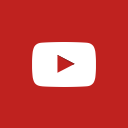Mit Donald Trump ist Politik eine Show, für die er jeden Morgen das Drehbuch schreibt. Seit seiner Rückkehr hat der 47. Präsident seinen Ruf bestätigt: Man kann alles erwarten, vor allem das Gegenteil. Zwischen wirren Äußerungen aus einem Oval Office, das eher einem Reality-TV-Studio gleicht, und seinen Tweets, die er über sein persönliches soziales Netzwerk – eine Festung ohne Widerspruch – verbreitet, ist sein Stil einzigartig. Tweets, die in ihrer Subtilität an die Blähungen unserer korsischen Esel nach einer zu reichhaltigen Mahlzeit mit Macchia-Kräutern erinnern. In diesem Klima schien die Frage von Hedy Belhassine nach Trumps Chancen auf den Friedensnobelpreis surreal. Die Reaktion des norwegischen Komitees, eine eisige und unmissverständliche Erklärung, ließ nicht lange auf sich warten. Einige Tage später jedoch paradierte der imposante atomgetriebene Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in der Norwegischen See. Sollten wir hier einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung sehen?
Welche strategische Bedeutung hat der Einsatz der USS Gerald R. Ford in der Norwegischen See im August 2025? Zwar gibt es stilistische Unterschiede zwischen der Biden- und der Trump-Regierung, doch besteht eine grundlegende Kontinuität in der amerikanischen Außenpolitik, die sich auf die Projektion militärischer Macht und den Wettbewerb der Großmächte konzentriert. Joël-François Dumont analysiert hier Donald Trumps Doktrin „Frieden durch Stärke” und hebt dabei deren transaktionalen Charakter sowie Trumps persönliches Streben nach dem Friedensnobelpreis als Bestätigung seines antiliberalen Ansatzes in den internationalen Beziehungen hervor. Sowohl die Biden- als auch die Trump-Regierung setzen trotz ihrer radikal unterschiedlichen Stile konsequent die Projektion militärischer Macht als Kerninstrument der US-Außenpolitik ein. Der grundlegende Unterschied liegt im Ziel dieser Macht: Biden will die liberale multilaterale Ordnung aufrechterhalten, während Trump sie zugunsten transaktionaler, unilateraler Vorteile abbauen will. Die USS Gerald R. Ford dient somit als starkes Symbol, das sich an zwei gegensätzliche Visionen des globalen Engagements anpassen lässt und gleichzeitig dauerhafte strategische Erfordernisse berücksichtigt, insbesondere die Konfrontation mit Russland in der Arktis.