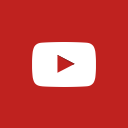Symphonie discordante d’un scandale planétaire :
Comme cette semaine vient de le démontrer, l’échiquier politique occidental a été renversé. Ce que nous observons n’est plus une simple accumulation de vices privés, mais une déflagration institutionnelle systémique. Du 10 Downing Street, désormais fragilisé, aux couloirs du Quai d’Orsay, en passant par les sièges sociaux de la finance francfortoise, l’onde de choc a ignoré les frontières. La « revue de presse » de cette semaine prouve que l’exposition des réseaux d’Epstein agit comme un acide sur la crédibilité des élites : elle ne dissout pas seulement des réputations individuelles, elle attaque la confiance dans la gouvernance même des États.
L’effet domino institutionnel
La mutation sécuritaire : Au-delà du fracas politique, une réalité plus sombre s’impose pour les semaines à venir : l’affaire a définitivement muté. Elle a quitté la rubrique des faits divers pour s’installer au cœur des enjeux de sécurité nationale. La question n’est plus seulement de savoir qui participait aux soirées, mais qui tenait la caméra et qui détient aujourd’hui les archives.